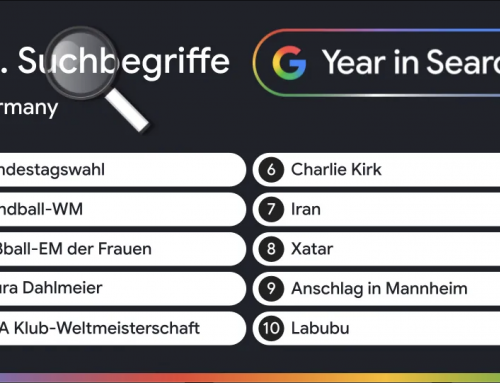Eines der stärksten Aushängeschilder
Was viele dabei unterschätzen: Hinter jedem Trikot steckt ein monatelanger Prozess, in dem Designfragen, Sponsorenwünsche, Produktionsrealitäten und strategische Entscheidungen aufeinandertreffen. Wer genauer hinschaut, erkennt: Ein Handballtrikot ist kein reines Stück Stoff – sondern Ausdruck von Identität, Organisation und Vermarktung.
„Im Fußball ist das Storytelling beim Trikot längst Standard. Im Handball hat das erst in den letzten Jahren angefangen“, sagt Stefan Bartsch. Er war zehn Jahre bei Erima tätig, zuletzt als Marketingleiter und Head of Sports Business Management. Heute ist er Managing Director der Marketingagentur Tailormade, die mit mehreren Handball- und Fußballklubs, aber auch Ausrüstermarken zusammenarbeitet.
Dieser Beitrag ist zuerst bei handball-world.news erschienen.
Von Standardtrikots zu Storytelling
Zu seinen Anfangszeiten gab es den Trend zu individuellen Trikotsdesigns im Handball noch kaum. „Früher waren es bei allen Ausrüstern oft Standardtrikots. Da wurde ein vordefiniertes Design genommen, Vereinsfarben und Logo drauf – fertig. Storytelling war da natürlich schwierig.“
Ein Wendepunkt kam mit der SG Flensburg-Handewitt. Dort wurden erstmals kleine Details wie individuelle Nackenbänder oder gestickte Elemente integriert. Später kamen Seekarten oder Designelemente, die an Schiffstauen orientiert waren – visuelle Bezüge zur Vereinsgeschichte und der maritimen Region.
Litfaßsäule oder einheitliche Sponsorenplatzierung?
Doch warum sehen viele Trikots trotzdem weiterhin überladen aus, wie Litfaßsäulen? Bartsch erklärt: „Das ist in erster Linie Vereinssache. Ob Sponsorenlogos einfarbig erscheinen oder bunt – das entscheidet der Klub mit seinen Partnern. Kiel und Flensburg haben es beispielsweise geschafft, dort klare Vorgaben zu machen. Aber nicht jeder Verein will oder kann sich das leisten.“
Einfarbige Sponsorenlogos verbinden viele Unternehmen oft mit geringerer Sichtbarkeit – und damit weniger Gegenwert. Auch mit der Aufgabe der eigenen Unternehmensfarben tun sich viele Sponsoren schwer. Wer als Verein darauf besteht, muss also mitunter finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.
Gleichzeitig erschwert die Vielzahl an bunten Logos auch die Produktion: „Wenn die Sponsoren nicht frühzeitig feststehen, müssen Logos nachträglich aufgeflockt werden. Das ist aufwendiger, teurer und weniger komfortabel für die Spieler. Besser wäre es, sie direkt ins Design zu integrieren und zu sublimieren – aber dafür braucht es Planungssicherheit.“
Deutlich mehr Aufwand als im Fußball
Diese fehlt im Handball häufig. Bartsch kennt Fälle, in denen noch kurz vor Saisonstart neue Sponsoren dazukommen – mit direktem Einfluss aufs Trikotdesign. Das ist nicht nur ein logistisches, sondern auch ein wirtschaftliches Problem. Denn: Ein Handballtrikot ist in der Produktion oft sehr viel teurer als ein Fußballtrikot.
„Es gibt viele Logos, unterschiedliche Größen, Farben und Formen. Da steht jemand und muss jede Seite einzeln beflocken. Das kostet Zeit und Geld.“ Hinzu kommen kleinere Stückzahlen. Während Fußballklubs teils 50.000 Trikots auf einen Schlag ordern, sind es im Handball eher wenige tausend Stück. Verkaufszahlen über 10.000 gelten bereits als herausragend. Kleinere Vereine bleiben oft im dreistelligen Bereich.
Höhere Kosten für Vereine
Während die Ausrüster im Fußball teils hohe Summen an die Klubs zahlen und sich dann über den Trikotverkauf refinanzieren, ist das Modell im Handball oft ein anderes. „Da gibt es viele Besonderheiten. Teilweise bekommen Vereine selbst in der Bundesliga kaum Geld, sondern nur Ware“, sagt Bartsch.
Für Ausrüster geht es eher um Imageaufbau, etwa um bei Amateurvereinen sichtbar zu sein oder bei lokalen Händlern aufzutauchen. Die Bundesligisten selbst profitieren zwar von Freiware für den Eigenbedarf, müssen aber für zusätzliche Ausstattungen – z. B. für Fanklubs oder Jugendteams – aufgrund der hohen Produktionskosten oft deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Die Entwürfe für die Trikots stammen meist aus dem Produktmanagement der Ausrüster, teils mit Unterstützung externer Designer. Bartsch: „Die großen Klubs bringen dabei oft eigene Ideen ein, kleinere fokussieren sich eher auf die Klärung der Sponsorenlogos.“
Das Trikot als emotionales Produkt
Immer wichtiger wird auch die Inszenierung des Trikotlaunches: Fotoshootings, Videos, Social Media – all das gehört mittlerweile zum Standard. „Die Fans sind oft dankbar für diese Emotionalisierung. Warum sollte das im Handball nicht funktionieren, wenn es in anderen Sportarten funktioniert?“ Eine gelungene Inszenierung könne laut Bartsch spürbare Effekte auf die Verkäufe haben.
Auch Sondertrikots sieht er grundsätzlich positiv – sofern sie eine gute Geschichte erzählen. Jubiläen, historische Titel oder regionale Bezüge seien gute Anlässe. „Aber ein Dschungeltrikot aus Nachhaltigkeitsgründen, für einen Spieltag – das hat wenig mit Markenbildung zu tun. Da denkt sich doch kein Fan: Das muss ich jetzt haben.“
Noch viel Potenzial
Trotz aller Hürden sieht Bartsch im Trikot einen unterschätzten Hebel: „Es ist eines der stärksten Aushängeschilder eines Vereins. Es wird von den Spielern getragen – und kann Identifikation schaffen wie kaum ein anderes Element.“
Ein starkes Trikot braucht daher nicht nur gutes Design, sondern klare Entscheidungen, frühzeitige Abstimmungen und ein Verständnis für seine strategische Rolle. Denn spätestens nach dem Launch ist schon wieder vor dem nächsten. Das nächste Trikot kommt bestimmt.
Du willst nicht nur lesen, sondern handeln?
Ich begleite Sportler:innen und Organisationen dabei, ihre Kommunikation zu ordnen, ihre Positionierung zu schärfen – und gezielt Wirkung zu entfalten.
👉 Du willst Themen wie Storytelling, Sichtbarkeit oder Markenaufbau im Sport nicht nur lesen, sondern angehen?
Dann wirf einen Blick auf mein Angebot für Sportler und die Leistungen für Organisationen im Sport.
Oder du sagst: Lass uns direkt sprechen.